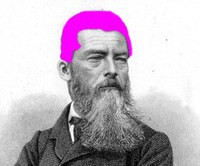DGB Bildungswerk Bayern
Seminarprogramm 2018 des Bildungswerks versendet!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es freut mich wieder sehr, euch das neue Bildungsprogramm des DGB Bildungswerks Bayern e. V. für das Jahr 2018 vorzulegen. Wie in der Vergangenheit haben wir uns darum bemüht, ebenso interessante wie relevante Inhalte für Betriebs- und Personalräte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Schwerbehindertenvertretungen anzubieten. Der Zweck unserer Angebote besteht im Kern darin, die betrieblichen Interessenvertretungen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, indem wir sie inhaltlich stärken.
Die betrieblichen Interessenvertretungen stark zu machen, bedeutet für uns als gewerkschaftlichem Bildungsträger gleichzeitig, die gewerkschaftliche Durchsetzungsfähigkeit insgesamt zu verbessern. Dieses gewerkschaftliche Bildungsverständnis setzt sich damit bewusst ab von Vorstellungen einer angeblichen „Neutralität“: Unsere Bildungsarbeit versteht sich immer auch als politische Bildungsarbeit.
Wie euch allen bekannt ist, finden im Jahr 2018 Betriebsratswahlen statt. Gerade in Zeiten der „Prekarisierung“ und all der Prozesse, die vielfach mit den Stichworten „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ beschrieben werden, sind handlungsfähige betriebliche Interessenvertretungen unverzichtbar. Nur sie – ausgestattet mit einem Grundverständnis von Einheitsgewerkschaft und umfassendem Wissen hinsichtlich ihrer Aufgaben – sind in der Lage, diese Prozesse aus Arbeitnehmersicht kritisch zu bearbeiten. Die Strategien der Arbeitgeberseite wie Kostensenkung, Arbeitsverdichtung und Flexibilisierung, die häufig zu Lasten der Beschäftigten ausschlagen, erfordern zwingend ein arbeitnehmerorientiertes Gegengewicht. Zur Qualität dieses Gegengewichtes beizutragen, das sehen wir als unsere Aufgabe.
Seid also alle herzlich eingeladen, an einem oder mehreren unserer Seminare teilzunehmen. Wir freuen uns sehr darauf, euch begrüßen zu dürfen.
Sabine Eger
Geschäftsführerin
Wer das Seminarprogramm nicht in Papierform erhalten hat, kann das Büchlein hier nachbestellen. Die Seminare sind auch in unserer Online-Suche zu finden. Außerdem empfehlen wir unsere nächsten Seminare zur Wahlvorstandsschulung in Regensburg, München, Augsburg, Nürnberg, Bamberg, Bad Berneck, Kemmern und Wernsdorf. Eine Übersicht der Wahlvorstandsschulungen ist hier im PDF-Format und hier online einsehbar.
28. Oktober: Die Volksgemeinschaft der Deutschen
Rechtsextreme Kreise von der AfD über die „Identitären“ und Pegida bis zu Neonazi-Zirkeln kämpfen in Tat und Propaganda gegen eine demokratische gesellschaftliche Ordnung. Um in dieser Auseinandersetzung besser gewappnet zu sein, soll es im Seminar um politische Strategien, ideologische Dogmen und Wurzeln der langen und verhängnisvollen Geschichte des antirepublikanischen Rechtsextremismus in Deutschland gehen. Im Begriff und der Geschichte der deutschen Volksgemeinschaft bündelt sich deren Agenda seit der vorletzten Jahrhundert-wende. Volksgemeinschaft bedeutet den autoritären Zusammenschluss eines willkürlich definierten Deutschtums gegen ein politisch Anderes, bedeutet Inklusion durch Exklusion.
Ihren grausamen Höhepunkt fand die deutsche Volksgemeinschaft unter der NS-Diktatur. Diese Volksgemeinschaft war nicht nur Mythos und Vision, wie in der Geschichtswissenschaft lange angenommen, sondern auch soziale Realität. Die massen-hafte Zustimmung der Volksgenossinnen und Volksgenossen war nicht nur gestellte Illusion und Propaganda, sondern handfeste Tat. Viele Deutsche nahmen die Rede von der Volksgemeinschaft ernst und betrachteten sie als Erlösung von gesellschaftlichen und sozialen Widersprüchen.
Die deutsche Volksgemeinschaft war keine Erfindung Hitlers und seiner Propaganda-apparate. Vorstellungen von einer klassen-harmonisierenden Einheit der deutschen Nation jenseits der Widersprüche einer kapitalistischen Klassengesellschaft und jenseits eines anstrengenden politischen Ringens um demokratische Mehrheiten bei Anerkennung und Würdigung des Anderen waren in unterschiedlichen Ausprägungen tief im deutschen Volk und seinen politischen Parteien – bis in die Sozialdemokratie hinein – verankert.
Die politischen Bilder einer Volks-gemeinschaft der Deutschen wirkten über die NS-Zeit hinaus lange in der Bundesrepublik fort und prägten die Adenauer-Ära, verschwammen in den politischen Eman-zipationsbewegungen seit den 1968er Jahren. Aktuell scheinen sie aber wieder Konturen zu bekommen.
Referent:
Dr. Peter Schyga, Freiberuflich tätig als Historiker und Publizist mit dem Büro KLIOpes in Hannover und als Referent des Vereins Erinnerung und Zukunft in der Region Hannover
Anmeldeschluss: Freitag, 20. Oktober 2017
Seminarbeginn: Samstag 28. Oktober 2017, 10:00 Uhr
Seminarende: Samstag, 28. Oktober 2017, 17:30 Uhr
Teilnahmebeitrag: 5 Euro
Seminarort: DGB-Haus München, Schwanthalerstraße 64, 80336 München
Anmeldung: per Mail
21. Oktober: Zur Lage und Politik der Europäischen Union
In den EU-Ländern regieren patriotische Europäer. Der Grundwiderspruch der die EU bildenden Nationen seit deren ersten Anfängen in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts besteht darin, einerseits als Projekt von Nationalstaaten mittels der EU weltweite Geltung vor allem gegenüber den USA zu erlangen, andererseits aber die nationale Souveränität nicht aufgeben zu wollen. Dies gilt nicht nur für die Eliten, sondern auch für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerungen, die auf ihrem gewohnten Patriotismus beharren.
Nun hat die Krise eine Vorstellung bekanntlich gründlich blamiert: die Vorstellung nämlich, dass alle beteiligten Nationen, vor allem die, die sich dem einheitlichen Geld namens Euro angeschlossen haben, in gleicher Weise erfolgreich sind. Stattdessen haben wir es mit einer Scheidung der beteiligten Nationen in Gewinner und Verlierer zu tun. Dies führt in den Bevölkerungen der einzelnen Länder, und zwar nicht nur den der Gewinner, sondern auch den der Verlierer, die sich harte Verarmungsprogramme aufdrücken lassen und Eingriffe in ihre nationale Fiskalpolitik hinnehmen mussten, zu erheblichem Unmut und den entsprechenden nationalistischen Reaktionen. Viele empfinden die EU und ihre Krisenpolitik als eine einzige Zumutung.
Hinzu kommen weltweite Fluchtbewegungen mit gewissen Konsequenzen auch für Europa. Auch bei diesem Thema definieren die einzelnen Länder ihre Interessen ganz unterschiedlich, ja sogar in teils konfrontativer Weise gegensätzlich. Wie schon in der Krisenpolitik auf ökonomischem Gebiet tun sich in der Frage Flucht und Migration tiefe Gräben auf, nicht zuletzt zwischen der Bundesrepublik, die mit klaren Ansprüchen an die anderen Nationen herantritt, und Ländern, die ihr nationales Interesse gänzlich anders als Deutschland definieren und bilanzieren.
Diese Gesamtlage wird noch berührt von einer US-Präsidentschaft, die ihrerseits dabei ist, die eigenen nationalen Interessen neu zu definieren und die Beziehungen zur Welt neu zu ordnen.
Referent:
Frank Lamers, Freier Journalist
Anmeldeschluss: Freitag, 13. Oktober 2017
Seminarbeginn: Samstag 21. Oktober 2017, 10:00 Uhr
Seminarende: Samstag, 21. Oktober 2017, 17:30 Uhr
Teilnahmebeitrag: 5 Euro
Seminarort: DGB-Haus München, Schwanthalerstraße 64, 80336 München
Anmeldung: per Mail
23. September: Religionskritik – historisch und aktuell
Wenn auch die Masse der Gläubigen der großen Weltreligionen nicht mehr allzu viel glaubt, gibt es doch immer mehr Religiosität bis hin zum Fanatismus. Mit dem Philosophen und Hegel-Schüler Ludwig Feuerbach kam es im 19. Jahrhundert zu einer wichtigen Änderung der religionskritischen Argumentationsmuster. Es ging von da an nicht mehr um die Wahrheit oder Unwahrheit von Offenbarungen und Dogmen, sondern um die Entzifferung ihres menschlichen Sinns. Marx hat diese neue Religionskritik umgemünzt in die Kritik einer unmenschlichen gesellschaftlichen Wirklich-keit, Freud hat sie aufgegriffen für die Heilung seelischer Leiden.
Im Seminar wollen wir uns zunächst darüber austauschen, welche Rolle Religion in unserer eigenen Entwicklung gespielt hat und welche Zweifel zu Veränderungen geführt haben, bzw. zum Aufgeben religiöser Gewissheiten. Diese Einstiegsaspekte werden wir dann mit den verschiedenen religionskritischen Argumentationsmustern seit der „Aufklärung“ vergleichen.
Besondere Aufmerksamkeit widmen wir dann der „kopernikanischen Wende“ in der Religionskritik, für die der Name Ludwig Feuerbach steht. Bei ihm gibt es zugleich einfühlendes Verstehen der religiösen Gefühle wie auch die Ablehnung der theologischen Rechtfertigung der Religion.
Für die Art und Weise, wie Marx die Feuerbachsche Religionskritik aufgegriffen hat, steht vor allem seine „Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“. Aber auch im „Kapital“ taucht die Religionskritik wieder auf: Im Band 1 nämlich, beim Thema Waren- und Geldfetischismus. Anhand dessen kann die religiöse Befangenheit von der „bürgerlichen Ideologie“ unterschieden werden, die Marx als gesellschaftlich notwendig falsches Bewusstsein verstand. Daraus auszubrechen gelingt nach Marx nicht einfach im Kopf, sondern nur durch eine „revolutionäre Praxis“, durch die Selbstbefreiung der lohnabhängigen Klasse mittels der solidarischen, emanzipatorischen und selbstbestimmten Aktion.
Zum Abschluss des Seminars wollen wir darüber diskutieren, inwieweit und in welcher Weise Religionskritik gegen religiösen Fanatismus wirksam werden kann.
Referent:
Dr. Manuel Kellner, Buchautor, Publizist und Dozent in der Erwachsenenbildung
Anmeldeschluss: Freitag, 15. September 2017
Seminarbeginn: Samstag 23. September 2017, 10:00 Uhr
Seminarende: Samstag, 23. September 2017, 17:30 Uhr
Teilnahmebeitrag: 5 Euro
Seminarort: DGB-Haus München, Schwanthalerstraße 64, 80336 München
Anmeldung: per Mail
Experten-Gespräch beim SAP-Fachtag: Es bleibt leider kompliziert

Nächstes Jahr gilt in Europa eine neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtend. Gemeinsam mit einem kürzlich beschlossenen neuen Bundesdatenschutzgesetz ändert sich damit einiges – auch für den Beschäftigtendatenschutz. Frank Steinwender vom TBS-Netz formulierte auf dem Podium der SAP-Fachtagung allerdings eine scharfe Kritik: „Wir nehmen vor Ort nicht wahr, dass die EU-Grundverordnung in den Betrieben schon geregelt wird. Datenschutz wird von Arbeitgebern nicht wirklich ernstgenommen.“ Das sieht die Juristin Eva Barlage-Melber vom Arbeitgeberverband etwas anders: „Ich erlebe in den Unternehmen eine große Sensibilität. Und ich stelle fest, dass die Sensibilität beispielsweise dahin geht, Daten zurück nach Europa zurückzuholen“, sagt sie. Datenschutzexperte Peter Wedde hat ganz grundsätzliche Einwände. Bei der Grundverordnung gewinne im Zweifelsfall häufig der freie Datenverkehr gegen den Datenschutz, so der Professor.
Personalverarbeitungssysteme kontrovers
Nikolaus Krasser von der Pentos AG machte sich für Personalentwicklungs-Systeme stark: „Viele Unternehmen sind bei der Personalverwaltung noch in der Steinzeit. Das laufen häufig noch Excel-Listen“, kritisiert er. Frank Steinwender vom TBS-Netz warb hingegen auch für ein „Recht auf Nichtentwicklung“:
"Wir sollten auch über das ‚Recht auf Nichtentwicklung‘ sprechen. Wenn ich zufrieden bin in meinem Job, sollte ich auch die Möglichkeit haben, mich nicht andauernd entwickeln zu müssen. Im Bereich des Fachwissens schon, aber nicht im Sinne einer permanenten Personalentwicklung."
Fehlende IT-Systeme seien jedenfalls nicht der Grund, weshalb viele Unternehmen ein Problem hätten, gute Leute zu finden, sagt Wedde. „Das liegt häufig schon eher an den schlechten Arbeitsbedingungen.“ Dennoch führe kein Weg an der neuen Technologie vorbei, bekräftigt Verdi-Vorstand Lothar Schröder: „Wir werden jetzt nicht hingehen, die Armee verschränken wie in den 80er-Jahren und sagen: Personalverarbeitungssysteme kommen und nicht in die Betriebe.“ Damit sei man nämlich schon damals nicht sonderlich erfolgreich gewesen.
„Roboter haben längst ihre Käfige verlassen“


 Zuvor skizzierte Schröder die Digitalisierung der Arbeitswelt. Küchen mit Roboterarmen, eine Kiste namens Starship fährt Pakete aus. In einer Berliner Klinik befördern mittlerweise Roboter die Wäsche. „Roboter haben längst ihre Käfige verlassen“, sagt Schröder. Davor könne man sich nicht verschließen, aber der Datenschutz müsse ernst genommen werden und dem „informationellen Exhibitionismus“ etwas entgegengesetzt. Daten seien in den Betrieben nämlich auch zu Disziplinierungsfaktoren geworden, warnte Schröder. Ähnlich dem Index „Gute Arbeit“ müsse man jetzt einen „Index Arbeitnehmerdatenschutz“ aufbauen. Schröder verwies auf die Verdi-Projekte „Prementino“, „Cloud and Crowd“ sowie DiGAP zum Thema.
Zuvor skizzierte Schröder die Digitalisierung der Arbeitswelt. Küchen mit Roboterarmen, eine Kiste namens Starship fährt Pakete aus. In einer Berliner Klinik befördern mittlerweise Roboter die Wäsche. „Roboter haben längst ihre Käfige verlassen“, sagt Schröder. Davor könne man sich nicht verschließen, aber der Datenschutz müsse ernst genommen werden und dem „informationellen Exhibitionismus“ etwas entgegengesetzt. Daten seien in den Betrieben nämlich auch zu Disziplinierungsfaktoren geworden, warnte Schröder. Ähnlich dem Index „Gute Arbeit“ müsse man jetzt einen „Index Arbeitnehmerdatenschutz“ aufbauen. Schröder verwies auf die Verdi-Projekte „Prementino“, „Cloud and Crowd“ sowie DiGAP zum Thema.
Aber auch die Gewerkschaft müsse digitaler werden, forderte ein Betriebsrat. „Die Gewerkschaft muss digitaler kommunizieren. Wir brauchen Blogs und müssen in den Netzen aktiver sein.“ Da sei jetzt der DGB gefragt, so der Betriebsrat. „Leaken wir doch mal etwas mehr, was da arbeitgeberseitig abgeht.“
Datenschutz-Folgeabschätzung bleibt spannend

 Professor Peter Wedde ist ein ausgewiesener Experte für Datenschutz und Arbeitsrecht, weshalb der Jurist die Grundzüge und Änderungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gut überblicken kann. „Die datenschutzrechtliche Praxis in den Betrieben entspricht schon heute in vielen Fällen nicht den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben“, kritisierte Wedde. Und das werde mit der neuen Verordnung nicht unbedingt besser, zumal in vielen Bereichen immer noch eine nationale Gesetzgebung bestimmte Bereiche reguliere, anstatt eine einheitliche.
Professor Peter Wedde ist ein ausgewiesener Experte für Datenschutz und Arbeitsrecht, weshalb der Jurist die Grundzüge und Änderungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gut überblicken kann. „Die datenschutzrechtliche Praxis in den Betrieben entspricht schon heute in vielen Fällen nicht den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben“, kritisierte Wedde. Und das werde mit der neuen Verordnung nicht unbedingt besser, zumal in vielen Bereichen immer noch eine nationale Gesetzgebung bestimmte Bereiche reguliere, anstatt eine einheitliche.
Positiv hob Wedde jedoch das Marktort-Prinzip hervor, wonach sich ein Unternehmen an die Datenschutzbestimmung des Ortes halten muss, an dem es wirtschaftet. Neu ist auch die Datenschutz-Folgeabschätzung: „Betriebsräte können in Zukunft von Arbeitgebern verlangen, die Risiken von Techniken für die Beschäftigten einzuschätzen.“ Ein Chance sieht Wedde auch in der Möglichkeit, sich von einer Institution vertreten zu lassen. „Betroffene können ihre Rechte jetzt von Einrichtungen wahrnehmen lassen“, sagt Wedde. Die Gewerkschaften seien hier gefragt. Es gelte nun einen Institution mitzugründen, die die Rechte der Beschäftigten im Datenschutzbereich wahrnimmt.
Mehr Berichte zu den SAP-Fachtagungen des TBS-Netzes gibt es hier nachzulesen.
Artikelaktionen