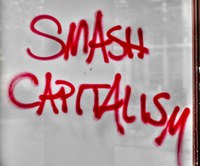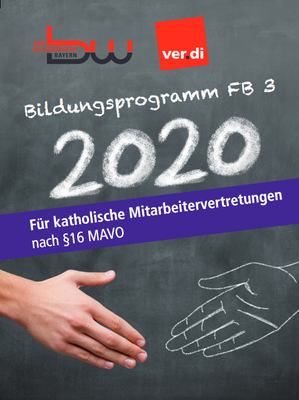DGB Bildungswerk Bayern
7. März: Einmaleins der Kapitalismuskritik
Viele sprechen von Neoliberalismus und Globalisierung, einige vom Raubtier- oder Kasinokapitalismus, als ginge es bloß um Auswüchse. Manche unterscheiden Kapitalismus und Marktwirtschaft, andere Finanzwirtschaft und „Realwirtschaft“ als wären es Paralleluniversen. Nach rechts anschlussfähig ist die Rede von den Heuschrecken oder der Herrschaft der internationalen Hochfinanz. Antisemitisch ist die Hetze gegen Rothschild und George Soros.
Im Seminar werden aktuelle und historische Varianten der Kapitalismuskritik in ihrem Kontext dargestellt und kritisch analysiert. Dabei zeigt sich, dass Kapitalismuskritik kein Privileg der Linken war oder ist. Es gab und gibt konservative, reaktionäre, rechte und völkische, nationalliberale und sozialreformerische Ansätze, neben anarchistischen, sozialistischen und kommunistischen Theorien.
Diese Ansätze werden mit der Marx’schen Kritik der politischen Ökonomie konfrontiert. Karl Marx kritisierte das Kapital als dynamisches Verhältnis, als Gesellschaftsform. Profitmaximierung und Akkumulation von Kapital sind der Zweck der Veranstaltung, nicht die Befriedigung von Grundbedürfnissen. Dafür sind Fabriken und Büros, Banken und Börse, Kaufladen und Supermarkt gleichermaßen notwendig, ein integriertes System aus Produktion, Finanzen und Handel.
Marx entwickelte eine Geld- und Krisentheorie und beschäftigte sich mit Aktiengesellschaften als am weitesten entwickelter Form des Kapitals. Damit bildet sein Werk eine wichtige Grundlage für die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen.
Referent: Peter Bierl, Politikwissenschafter und freier Journalist
Seminarzeiten: Samstag 07. März 2020, 10:30 Uhr - 17:00 Uhr
Teilnahmebeitrag: 5 Euro
Seminarort: Gewerkschaftshaus Nürnberg, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg
Anmeldung: per Mail
Abgesagt: Fachtagung 18. März: Schwerpunkt: Weiterbildung

[Abgesagt] Mit der Digitalisierung verändern sich Arbeitsprozesse, Arbeitsorganisation und Produkte immer schneller. Beschäftigte und Unternehmen sehen sich ständig neuen Anforderungen ausgesetzt. Mit den neuen technischen Möglichkeiten steigt auch die Unsicherheit bei den Arbeitenden: Ist mein Arbeitsplatz „zukunftssicher“? Was muss ich tun, damit ich auch weiterhin „beschäftigungsfähig“ bleibe?
Eine zentrale Antwort auf diese Entwicklungen ist die betriebliche Weiterbildung. Doch wie muss diese gestaltet sein, damit die Arbeiten-den nicht zum Spielball unternehmerischer Anforderungen werden? Welche Möglichkeiten gibt es für betriebliche Interessenvertretungen, Weiterbildung vorausschauend mitzugestalten? Diesen und weiteren Fragen widmet sich die Fachtagung 2020 des DGB Bil-dungswerk Bayern.
Ausgehend von aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt gibt sie einen Überblick über das Feld der betrieblichen Weiterbildung.Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten für betriebliche Interessenvertretungen.
Mit:
- Matthias Jena (Vorsitzender DGB Bayern)
- Dr. Sarah Nies (Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung München)
- Prof. Dr. Wolfgang Menz (Universität Hamburg)
- Torsten Weber (TIBAY)
- Dr. Manuel Rühle (Pädagogischer Leiter DGB Bildungswerk Bayern)
- Dr. Christopher Franke (Weiterbildungsberater DGB Bildungswerk Bayern)
Freistellung und Kostenübernahme: Bei der Fachtagung handelt es sich um eine Veranstaltung für betriebliche Interessenvertretungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG, Art. 46 Abs. 5 BayPVG, § 46 Abs. 6 BPersVG, § 96 Abs. 4 SG
Veranstaltungszeit: Mittwoch 18. März 2020, 10:00 – 16:00 Uhr
Veranstaltungsort: Gewerkschaftshaus München Ludwig-Koch-Saal, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
Anmeldung offline: Hier geht es zum Flyer
Anmeldung online: Folgt
Bildungswerk präsentiert erstmals Jahresprogramm für MAV der katholischen Kirche
15. Februar: Die (Neue) Rechte und der Staat in Lateinamerika
Doch ist dieser Aufstieg wirklich so neu? Welche gesellschaftlichen Gruppen sind von der Politik der lateinamerikanischen Rechten besonders betroffen und in welcher Weise? Tatsächlich ist das Bild von einem natürlich zu Ende gehenden, progressiven Zyklus etwas irreführend, denn Politik ist immer umkämpft; unterschiedliche Interessen können sich mal mehr, mal weniger in staatlicher Politik durchsetzen und haben u. U. mit starken Beharrungskräften des Staates im Kapitalismus zu kämpfen.
Ziel des Seminars ist es, den „militanten Konservatismus“ besser einordnen zu können. Im Fokus stehen Mexiko, Kolumbien und Brasilien. Diese drei Beispiele sind sehr unterschiedlich und erlauben uns ein komplexeres Bild der Region zu entwerfen. So scheint sich in Mexiko der Wind gedreht zu haben. Die Neue Rechte, die die eskalierenden Gewaltraten seit 2007 mit verantwortet, hat einem Präsidenten Platz gemacht, der unter progressiven Kräften im Land viel Hoffnung geweckt hat, aber auch viel Kritik erfährt. In Kolumbien hat der bewaffnete Konflikt jahrelang den militanten Konservastismus legitimiert.
Doch trotz des 2016 geschlossenen Friedensvertrages zwischen Staat und FARC-Guerilla nehmen die Mordraten insbesondere an GewerkschafterInnen und LandaktivistInnen, indigenen VertreterInnen und MenschenrechtlerInnen nicht ab. Besteht hier ein Widerspruch? Dass in Brasilien die Neue Rechte nicht nur zu Gewalt auffordert, sondern ökologische Spannungsverhältnisse auf die Spitze treibt, ist längst ein globales Thema geworden. Doch was bedeuten diese Dynamiken für politisch aktive Menschen in Brasilien?
In jedem Fall hat die Rechtswende gesellschaftliche Widersprüche verschärft: Austeritätspolitik, Flexibilisierung von Arbeit und die Aufgabe der Kontrolle über Ressourcen gehen einher mit der Kriminalisierung von Protest.
Referentin: Dr. Alke Jenss, Soziologin, Arnold-Bergstraesser-Institut Freiburg
Seminarzeiten: Samstag 15. Februar 2020, 10:30 Uhr -17:00 Uhr
Teilnahmebeitrag: 5 Euro
Seminarort: Gewerkschaftshaus München, Schwanthalerstraße 64, 80336 München
Anmeldung: per Mail
25. Januar: Die Weimarer Republik - Gründe des Scheiterns und Konsequenzen für die Gegenwart
Anders als oft wahrgenommen, war die Weimarer Republik nicht in einer Dauerkrise. Krisenphasen sind von Phasen einer relativen Stabilisierung zu unterscheiden. Die Legitimationsbasis für die regierenden Parteien schwankte stark, je nach ökonomischer und sozialer Lage.
Am Beginn der Weimarer Republik stand ein asymmetrischer Klassenkompromiss der MSPD mit den Eliten des Militärs, der Wirtschaft und der Verwaltung. Nur der politische Überbau wurde demokratisiert und sozialpolitische Reformen wurden durchgeführt. Die ökonomischen, militärischen, bürokratischen und kulturellen Machtpositionen blieben jedoch weitgehend in der Hand der konservativen bzw. reaktionären Elite aus der Zeit des Kaiserreiches. Mit der Verschärfung der ökonomischen Krise ab Herbst 1929 wurde dieser anfängliche asymmetrische Klassenkompromiss auf der (sozial-)politischen Ebene von den Eliten immer mehr aufgekündigt.
Die politische Demokratie wurde zunächst durch Präsidialkabinette ausgehöhlt, die mit Notverordnungen des Reichspräsidenten Hindenburg ausgestattete waren. Mit der politischen Machtübertragung an die NSDAP wurde sie schließlich abgeschafft.
Erleichtert wurde diese Politik durch eine zutiefst gespaltene Arbeiterbewegung (MSPD und USPD, ab 1920 SPD und KPD).
Das Seminar zeichnet diese Entwicklungen nach und fragt danach, welche Lehren sich aus dem Scheitern der Weimarer Republik für die Gegenwart ziehen lassen. Wenngleich man bei historischen Vergleichen stets vorsichtig sein muss (2020 ist sicher nicht 1930 oder 1933), ist es angesichts einer erstarkten AfD doch sinnvoll zu ergründen, welche Ursachen dieses Scheitern hatte.
Referent: Dr. Ernst Wolowicz, Sozialwissenschaftler
Seminarzeiten: Samstag 25. Januar 2020, 10:30 Uhr -17:00 Uhr
Teilnahmebeitrag: 5 Euro
Seminarort: Gewerkschaftshaus München, Schwanthalerstraße 64, 80336 München
Anmeldung: per Mail
Artikelaktionen